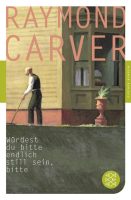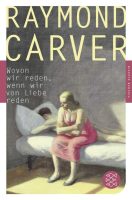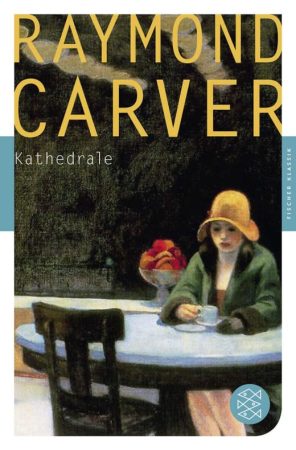
Die Kurzgeschichtensammlung „Kathedrale“ enthält neben der titelgebenden Story elf weitere – und die meisten haben mich wieder begeistert.
Inhalt
Aus zwölf Kurzgeschichten besteht die Sammlung „Kathedrale“ von Raymond Carver.
Ich bin durch die titelgebende Story auf den Autor aufmerksam geworden, denn in dem Werk von A. Steele („Creative Writing: Romane und Kurzgeschichten schreiben“) wird die Geschichte besprochen, die im Anhang komplett abgedruckt ist. Danach fiel mir „Würdest du bitte endlich still sein, bitte“ in die Hände – ein Volltreffer! Und „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“ ist ebenfalls ein Favorit geworden.
Nun also: „Kathedrale“. Auch hier geht es um einfache Menschen in Ausnahmesituationen, um Charaktere, die zu viel trinken und schwerwiegende Entscheidungen treffen. Ich kannte das, ich wollte es. Ebenso wie die Tatsache, dass uns Carver lediglich Einzelteile gibt, die wir zu einem Bild zusammensetzen müssen, um zu verstehen, was wir da lesen. Das macht den Reiz seiner Kurzgeschichten aus – und ich hatte wieder viel Spaß mit der Sammlung, auch wenn ein paar Titel weniger zu mir sprachen und ich nach „Vitamine“ eine Pause brauchte.
Übersicht
Ich habe zu jeder Kurzgeschichte meine Gedanken und Interpretation aufgeschrieben. Ein Klick bringt dich direkt zu dem Titel aus „Kathedrale“, den du suchst:
Federn
Originaltitel: Feathers
Ich-Erzähler Jack und seine Frau Fran sind bei seinem Arbeitskollegen und Freund Bud eingeladen. Sie waren noch nie zuvor dort, allgemein leben Jack und Fran in ihrer eigenen Welt, kennen nicht einmal die Gegend, in der sie seit drei Jahren wohnen. Frans Sätze wie„… oder was immer die Leute in Filmen trinken“ (S. 12) weisen darauf hin, dass sie kaum soziale Kontakte, keine Ahnung von Freundschaften haben. Obwohl Bud seit acht Monaten Vater ist, hat Jack das Baby noch nie gesehen.
Der Titel kommt mit dem Vogel ins Spiel, der vor ihrem Auto landet, als sie bei den Gastgebern ankommen. Es ist ein Pfau, er heißt Joey – und er darf ins Haus. Wir finden heraus, dass er ein lang gehegter Wunsch von Buds Frau Olla war. Olla hat sich mit Bud so einige Wünsche erfüllt, etwa schöne Zähne, von denen sie vorher nur träumen konnte. Sie ist dankbar, erinnert sich daran, es zu sein – und macht dadurch einen glücklichen Eindruck. Auch mit ihrem nicht sehr ansehnlichen Sohn ist sie zufrieden. Als Jack und Fran gehen, kommen die Federn zum Vorschein: Ein Geschenk von Olla, das noch bedeutsam werden wird.
Wichtig ist, dass Jack und Fran vor dem Besuch nicht viel vermisst haben. Sie wollten ein neues Auto, dachten an Kanada, es waren Träumereien, keine unbedingten Ziele wie Olla sie hatte, die schon als Kind ein Bild eines Pfaus über ihr Bett pinnte. Kinder waren noch nicht geplant. Direkt nach dem Abendessen sieht es anders aus: Fran wird gewollt schwanger. Doch sie wird dadurch keine dankbare Frau, sie wird nicht wie Olla, nicht glücklich.
Ich lese es so, dass sie sich mit den „fremden Federn geschmückt“ hat, sie hat sich Ollas Leben (symbolisiert durch die Annahme der Federn, die wie der Mais usw. ein Fruchtbarkeitssymbol sind) zum Vorbild genommen, die sich ihre Wünsche erfüllt hat, sie hat sich hineingedacht – und ist eine Version von ihr geworden. Nun hat sie ein Kind, das sie nicht wollte, kein Auto, keine Reise. Der Name Fran kann für frei/die Freie stehen, das ihr eher entsprechen würde als das Mutterdasein.
Auch optisch hat sie sich ihr angeglichen, was Jack missfällt. Eingangs heißt es „Ich sage ihr, dass ich mich wegen ihres Haares in sie verliebt hab. Ich sage ihr, ich würde aufhören, sie zu lieben, wenn sie es sich abschneidet.“ (S. 11) Das Haar ist ab. Er ist noch da. Wird er bleiben?
Glücklich sind beide nicht. Es ist entscheidend, dass man seine eigenen Träume lebt, nicht die eines anderen. Olla hat sich ihr Paradies mit dem Pfau (Paradiesvogel) und den Tomaten („Paradiesäpfel“) vorm Haus geschaffen, es ist allerdings nicht Frans Vorstellung vom Paradies – nun aber ihr Leben.
Chefs Haus
Originaltitel: Chef‘s House
Protagonist der Story ist Wes, der bereits mit 19 ein verheirateter Mann mit zwei Babys war. Seine Kinder Cheryl und Bobby sind inzwischen erwachsen, es besteht kein Kontakt, vermutlich, weil Wes ein Alkoholiker ist.
Wir lesen die Kurzgeschichte als Erinnerung, was das Weglassen der Anführungszeichen unterstreicht, aus Sicht seiner (Ex-) Frau Edna, die sich wieder auf ihn einlässt, als er sie anruft und um Beistand bittet. Er will den Sommer in dem möblierten Haus von einem Mann namens Chef verbringen und trocken werden. Trotz Bedenken verlässt sie ihren Freund und fährt die 600 Meilen.
Sie nähern sich an, Edna trägt sogar ihren Ehering wieder, ja, sie haben eine gute Zeit. Wes schafft den Absprung in dem Haus. Für ihn ist die Abstinenz aber mit dem Ort verbunden. Hier, inmitten von Chefs Sachen, der selbst ehemaliger Alkoholiker ist, gelingt es ihm, ein anderer zu sein, doch als er die Nachricht erhält, dass sie ausziehen müssen, weiß er, dass er erneut scheitern wird. Edna versucht, gegenzusteuern, ahnt jedoch wahrscheinlich, dass er recht hat. Die Erwähnung, dass sie ihren Ehering einst im Zusammenhang mit seinem Trinken abnahm, nimmt vorweg, dass es nicht funktionieren wird, wenn der Kreislauf wieder in Gang kommt – und das wird er, wenn Wes aus dem für ihn sicheren Haus rausmuss. Entsprechend gehe ich davon aus, dass sie sich früher oder später erneut anderen Partnern zuwenden werden, die allerdings nie den Stellenwert in ihrem Leben einnehmen werden, wie Edna für Wes und Wes für Edna – auch wenn es nicht klappt mit den beiden „im echten Leben“.
Konservierung
Originaltitel: Preservation
Sandys Mann ist seit drei Monaten arbeitslos. Er ist ins Wohnzimmer gezogen, lebt auf dem Sofa. Sandy findet heraus, dass er offenbar fasziniert von einer Buchseite ist, auf der es um einen nach 2000 Jahren entdeckten Toten aus einem niederländischen Torfmoor geht. Er kommt über diese Stelle nicht hinaus, hängt fest – wie in seinem Leben.
Wir haben hier keinen Ich-Erzähler, es wird über das Paar berichtet. Man spürt Sandys Hilflosigkeit, einmal heißt es, „(…) als wären sie normale Menschen“ (S. 46) – sie sind es in ihren Augen nicht mehr, seit ihr 31-jähriger Mann kaum noch vom Sofa aufsteht. Sie schämt sich.
Als sie die Geschichte des Onkels ihrer Freundin hört, der seit Jahrzehnten (ebenfalls aus eigener Idee heraus) im Bett liegt, kriegt sie Panik. Doch dann passiert etwas:
Sie kommt nach Hause und stellt fest, dass der Kühlschrank nicht mehr kühlt, alles ist aufgetaut, droht zu verderben. Und das holt ihn vom Sofa, aus dem Wohnzimmer, führt ihn in die Küche, bringt ihn dazu, sich auf Ursachenforschung zu begeben. Er ist endlich wieder aktiv.
Sie brät Koteletts, damit sie sie nicht wegwerfen muss, und fühlt sich beim Anblick an ein Grabwerkzeug erinnert. Er wird herausgeholt aus seinem Zustand, in den er so tief versunken ist.
Um ein neues Gerät zu holen, will Sandy auf eine Auktion gehen, obwohl der letzte Auktionsfund ihres Vaters ihn sein Leben kostete – und ihr Ehemann erklärt sich bereit, mitzukommen. Die große Veränderung ist überfällig, sie gehen das Risiko ein, sie müssen es.
Er war wie konserviert, eingefroren – und nun taut er auf, erwacht aus der Erstarrung. Der Kühlschrank, der Kältemittel verliert, ist der Mann, der plötzlich zwischen Pfützen steht.
Nun ist diese Geschichte bis hierher positiv zu lesen. Doch im letzten Satz kehrt er aufs Sofa zurück. Ein schlechtes Zeichen? Was wird passieren: Geht er zur Auktion? Wird er sich verändern?
„Konservierung“ ist eine von den Kurzgeschichten, deren Ende man verschiedentlich auslegen kann. Ich möchte daran glauben, dass alles gut wird. Schließlich hat er überlegt, ob sie überhaupt einen Kühlschrank brauchen – er freundet sich bereits an mit dem Gedanken, ohne zu sein. Es ist möglich, dass ihn der Anblick der tauenden Lebensmittel, die zu stinken anfangen, aufgeweckt hat. Er hat noch Zeit, sein Leben zu gestalten – irgendwann muss er herauskommen aus seiner selbstgewählten Erstarrung, spätestens, wenn er selbst zu verrotten droht/stirbt. Dann doch lieber jetzt. Ich denke, dass er sich von diesem sehr eindrücklichen Bild erholen muss. Aber er wird wieder aufstehen vom Sofa und zur Auktion gehen. Oder? ODER?
Am liebsten hätte ich gehabt, dass am Ende ein Name steht. Der Mann bleibt die Geschichte über namenlos. Hätte dort gestanden: „XY ging aufs Sofa“, hätte das für mich signalisiert, dass er wieder eine Identität, ein Leben kriegt. Das wäre eindeutig gewesen. Stattdessen werden die Füße betont, die sowohl für den Stand als auch die Fortbewegung stehen – und ihn ins Wohnzimmer tragen. Es ist schwierig. Wir lesen Raymond Carver, deshalb dürfen wir nicht erwarten, dass uns etwas Glasklares entgegenspringt, sondern müssen einkalkulieren, dass es weitergeht wie bisher. Das wäre schade, aber an diesem Punkt stelle ich wieder einmal fest: Es sind die nebulösen Storys, die mich besonders faszinieren, weil ich mir ewig den Kopf darüber zerbrechen und trotzdem mit Spaß dabei sein kann, wie auch immer das möglich ist.
Das Abteil
Originaltitel: The Compartment
Myers reist mit der Eisenbahn nach Strasbourg, um nach acht Jahren der Funkstille seinen Sohn zu treffen. Während der Reise werden uns verschiedene Dinge über ihn bewusst:
- Er fährt mit der Bahn (nicht mit dem Auto, das er sich vermutlich leisten könnte, schließlich hat er einen soliden Beruf, fährt erster Klasse, kauft teure Geschenke. Nein, er nimmt die vorgegebenen, die eingefahrenen Wege. Er ist nicht frei).
- Er mag Mauern (er hat nichts gegen Isolation, will sich abschotten, schützen).
- Er projiziert die ganze Schuld und all seine Wut über das Scheitern der Ehe/Familie auf den Sohn. Einst hat er angedroht, sein eigen Fleisch und Blut umzubringen. Nun, acht Jahre später, reist er wegen des Briefes seines Sohnes nach Frankreich, nur um festzustellen, dass er seinen Groll nicht ablegen kann.
- Er wird beklaut, als er die Toilette aufsucht. Es handelt sich um das Geschenk für den Sohn, eine japanische Uhr, die er in Rom gekauft hat. Hier wird deutlich, dass er sofort bereit ist, allem und jedem die Schuld zu geben, nur sich selbst nicht. Vielleicht hat er sie verloren? Er denkt nicht eine Sekunde daran. Wie auch immer: Die Uhr ist weg. Die Zeit (der Erinnerung, gar einer möglichen Versöhnung) ist abgelaufen.
- Er ist neidisch, weil sein Gegenüber, ein in Basel Zugestiegener, schlafen kann. Dieser Punkt ist wichtig. Denn auch er kann schlafen, ganz am Ende, als er sich gegen eine Aussprache mit seinem Sohn entschieden hat und der Wagen abgekoppelt wurde. Der Zug ist abgefahren. Er hat seine Ruhe wiedergefunden, kehrt zurück in die Isolation (symbolisiert durch die fremden, eine andere Sprache sprechenden Menschen), in sein altes Leben mit den paar Kollegen und der Sekretärin, ohne Freunde, ohne Familie.
Für mich geht es hier klar darum, dass er Angst hat, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Ja, von mir aus ist seine Exfrau eine Alkoholikerin, aber er hat sicher nicht alles richtig gemacht, was schon der Bruch durch seine Unbeherrschtheit mit seinem Sohn zeigt. Er ist unsicher, über die Begegnung heißt es: „Tatsächlich wusste er nicht, was er sagen sollte.“ (S. 60)
Er ist nicht in der Lage, auf seine Fehler zu schauen, läuft lieber davon, auch wenn das heißt, ein einsames Leben zu führen. Der Satz, der uns alles sagt, lautet: „Er wusste, wenn er sich erlaubte, weiter über diese Dinge nachzudenken, konnte es ihm das Herz brechen.“ (S. 61) „Das Abteil“ ist eine arg traurige Geschichte.
Eine kleine, gute Sache
Originaltitel: A Small, Good Thing
Diese Geschichte habe ich nur überflogen, weil ich die Kurzversion namens „Das Bad“ in „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“ gelesen habe. Meine Gedanken dazu gibt‘s hier.
Tatsächlich ist „Eine kleine, gute Sache“ ausführlicher und verrät uns, was mit Scotty passiert. Die Identität des Anrufers wird ebenfalls enthüllt. Meine Vermutungen haben sich bestätigt, auch wenn der Schluss (der Besuch beim Bäcker) unerwartet kommt und etwas Neues hinzufügt.
Dennoch mochte ich die Kurzversion lieber, weil sie uns so zurücklässt, wie die Figuren zurückgelassen werden. Es fühlte sich stimmig an, trotz – und auch wegen – der Fragezeichen.
Vitamine
Originaltitel: Vitamins
Da haben wir sie: Die Geschichte, die ich am wenigsten mochte, eine sehr ungemütliche Story, die auch ein mieses Verhalten Frauen gegenüber sowie das N-Wort enthält.
Der namentlich nicht genannte Ich-Erzähler lebt mit Patti zusammen, die Vitamine an der Haustür verkauft. Zu ihrem Team gehören Sheila, die auf Patti steht und nach einer Party auf Nimmerwiedersehen (nach Portland) verschwindet, und Donna, auf die der Erzähler ein Auge geworfen hat.
Es fällt auf, dass er eifersüchtig ist, sich selbst aber höchst fragwürdige Erlaubnisse erteilt.
Die Beziehung zwischen Patti und ihm ist angespannt, sie nennt ihn „Bruder“ und will von ihm nicht „Schatz“ genannt werden, was wir verstehen: Er hört ihr nicht zu (nicht umsonst taucht später dieses Ohr auf), nimmt ihre Gefühle nicht wahr, sie nicht ernst. Er hat keinerlei Mitgefühl. Der Alkohol scheint sein bester Freund zu sein, er spielt in jeder Szene eine Rolle. Bemerkenswert ist auch, dass der Erzähler nach eigener Aussage nicht träumt. Er hat keine Träume, keine Ambitionen, sein Leben zu ändern. Und so stürzt er immer weiter ab.
Für mich geht es hier eindeutig um Alkohol und seine Folgen.
Auffällig ist, dass ständig Körperteile genannt werden. Dies ist passend zum Thema „Vitamine“, die schließlich gut für uns und unseren Körper sein sollen. Dem steht der Alkohol entgegen, der in diesem Ausmaß unweigerlich zum Absturz führt, was durch die herabfallenden Gegenstände am Schluss unterstrichen wird. Alles fällt herunter, alles geht den Bach herunter, alles um ihn herum bricht auseinander.
Portland steht für die Flucht, den Ausweg. Zunächst verschwindet Sheila, die was von Patti will und für sie arbeitet. Und mit Donna, die Portland ins Auge gefasst hat, geht jemand, der für beide bedeutsam war: Sie ist diejenige, die die meisten Einnahmen generiert. Und er wollte sie ins Bett kriegen.
Nun ist niemand mehr da, der sie unterstützt oder für Ablenkung und Hoffnung sorgt. Sie bleiben auf den gesunden Vitaminen sitzen, die ihnen nichts bringen, die sie nicht nutzen. Sie bleiben allein zurück – und um sie herum fällt alles zusammen wie ein Kartenhaus.
Vorsichtig
Originaltitel: Careful
Wir haben hier einen Mann mit Problemen: Lloyd trinkt und wacht eines Tages mit einem verstopften Ohr auf. Interessant ist, dass er unbedingt wieder klar hören will, obwohl er sonst nicht zuhört. Er lauscht weder dem Fernseher noch will er die Worte von seiner Ex-Partnerin Inez hören, wenn er vermutet, dass die etwas für ihn Negatives ausspricht. Tatsächlich scheint die Sorge berechtigt, denn sie hat ihn gebeten, auszuziehen, und als sie ihn aufsucht, tut sie es, um Dinge zu klären. Nichts deutet auf eine Versöhnung hin, sie hat sich äußerlich verändert (neue, sehr fröhliche Kleidung, er nimmt sie in einer „bunten Frühlingsaufmachung“ wahr), sie geht, weil sie einen anderen Termin hat – sie ist weitergezogen, während er in einer Wohnung voller Schrägen zurückbleibt, die ihn ständig in die Knie zwingt, und Champagner trinkt, den er versteckt.
Es geht um Gewohnheiten, darum, dass die eigenartigsten Dinge mit der Zeit normal werden können, hier anhand eines Suchtkranken, der die Tatsachen verdreht, sich passend puzzelt. Die Perspektive verändert sich, was an diversen Stellen zur Sprache kommt (Schräglage des Kopfes usw.). Situationen, die ihn einst verwunderten, sind inzwischen Alltag. Am Ende ängstigt er sich, auf der Seite zu liegen, und trinkt aus der Flasche – auch das kann ohne Weiteres zur Normalität werden, wenn er nicht ernstlich vorsichtig ist und radikal an sich und seinen Problemen arbeitet.
Von wo ich anrufe
Originaltitel: Where I’m Calling From
In „Von wo ich anrufe“ haben wir einen namenlosen Ich-Erzähler, über den wir wenig erfahren. Er ist in einem Entzugsheim, es ist sein zweiter Besuch.
Es kommt mir vor, als ob er ständig versucht, sich abzulenken, um zu vergessen, wer bzw. was er ist: ein Alkoholiker. Einzig seine Freundin und ihre schlechten Nachrichten möchte er nicht hören – weil sie ihn betreffen, Auswirkungen auf sein Leben haben werden. Ansonsten ist er bereit, sich auf die Schicksale seiner Mitmenschen zu fokussieren, um dem Problem, das er hat, nicht vollends ins Auge sehen zu müssen. Denn obwohl er freiwillig in die Klinik ging und auch jederzeit gehen kann, hält er sich vor allem davor, auf der Veranda, auf.
Um zu zeigen, dass er sich nicht auf sich, sondern andere konzentriert, berichtet er ausführlich von Tinys Anfall und lässt J. P., einen Schornsteinfeger um die 30, seine Geschichte erzählen. Er hat Angst, dass die Ablenkung endet (Stichwort Hufeisen-Werfen).
Doch wie der erwähnte Brunnen, der für mich die Selbstbegegnung und Verwandlung darstellen kann, haben solche Gespräche immer auch etwas mit einem selbst zu tun. Und so profitiert er letztlich aus dem Gesagten, das nur der Zerstreuung dienen sollte.
Ich bin mehrmals über den Kohleneimer gestolpert. Da ist etwas mit. Ich denke, das Ganze steht für Energie und Transformation, was das Thema unterstreicht. Denn es geht um das Sein. Dass das so ist, wird durch Sätze wie diese deutlich: „Außerdem, wer war denn dieser J. P.? J. P. was?“ (S. 151) Als müsste man zu jeder Zeit schon etwas sein, könnte nicht zu etwas werden – und das dann auch wieder hinter sich lassen, zumindest den aktiven Teil davon. Wie auf S. 151 erwähnt, oder auf S. 164 an der Stelle mit Roxy, an der er sieht: Sie war dies (Schornsteinfegerin) und ist es nun nicht mehr, kann aber immer noch das (Küsse verteilen). Oder das Beispiel Jack London: Er war ein toller Mensch und doch ist ihm dies und das passiert. Für ihn heißt das: Er ist ein Alkoholiker – und kann das (nicht alles von sich, aber das) durchaus hinter sich lassen. Er ist immer noch ein guter Mensch oder kann einer sein, er ist jemand mit dieser Krankheit, er wird jemand sein, ohne dass er trinkt. Diese Erkenntnis führt zur wichtigsten Stelle: Plötzlich weiß er, wer er ist. Kurz zuvor hat er den Ort vorgeschoben (wo er ist = wo er steht im Leben), sich Gedanken um anderes gemacht. Nun das, er will sagen: „Ich bin’s.“ (S. 166) Und das ist ein schönes Ende.
Der Zug
Originaltitel: The Train
Eine Geschichte voller Fragezeichen.
Zunächst fällt die Widmung auf: Für John Cheever. Wenn ich diesen in Zusammenhang mit der Hauptfigur Miss Dent durch die Suchmaschine jage, kommt dessen Kurzgeschichte „The Five-Forty-Eight“ heraus. Interessant. Erscheint alles klarer, wenn man die Story und Hintergründe von der Frau mit der Pistole in der Handtasche kennt? Warum hat sie den Mann bedroht? Was ist davor passiert?
Ich habe mir den Spaß gemacht und eine Zusammenfassung gelesen. Ich weiß jetzt, wieso sie Blake das angetan hat. Aber ich verstehe „Der Zug“ trotzdem nicht.
Denn auch die beiden anderen Figuren bleiben rätselhaft: eine Frau, die Miss Dent ständig in ihre bruchstückhafte Unterhaltung einbezieht, ein Mann, weißhaarig und barfuß, auf der Suche nach Streichhölzern. In Cheevers Geschichte (bzw. in der Kurzfassung) kommen sie nicht vor.
Wie die Passagiere im einfahrenden Zug am Ende bleibe ich zurück und frage mich, wer die Menschen sind und was vorgefallen ist. Vielleicht ist das die Botschaft: Man weiß viel weniger, als man denkt. Oft weiß man gar nichts, selbst wenn man einzelne Dinge sieht oder hört. Ohne Hintergrundwissen ist alles Spekulation, das reinste Zusammenreimen.
Fieber
Originaltitel: Fever
Anfang Juni verlässt Eileen Carlyle und die Kinder, um mit einem Kollegen ihres Mannes durchzubrennen. Wenn sie anruft, dann hauptsächlich deshalb, um den Kids in Erinnerung zu rufen, dass sie noch immer eine Künstlerin ist. Während dieser Gespräche scheint sie stets zu wissen, wie es Carlyle geht, und gibt ihm Ratschläge.
Wir sehen, dass Carlyle die Trennung nicht verkraftet. Auch die Suche nach einem Babysitter, schließlich muss er zurück an die High School, um zu unterrichten, läuft schlecht. Debbie, eine 19-Jährige, lädt Freunde ein und überlässt die Kids sich selbst (die Würfel am Rückspiegel sagen es voraus: Das Ganze ist ein Glücksspiel, von ihm eingeläutet, denn er hat sie nicht überprüft, sondern blind vertraut, womit er schon einmal gescheitert ist). Erst als die alte Mrs. Webster durch Intervention von Eileen auf den Plan tritt, sind Keith und Sarah wieder in guten Händen. Mrs. Webster ist die entscheidende Figur in „Fieber“. Seit sie da ist, verändert er sich, wir sehen das beispielsweise in seinem Verhalten Carol gegenüber, einer Kollegin, mit der er (eigentlich klammheimlich) etwas am Laufen hat.
Es geht hier um Abschiede. Carlyle hat es nie geschafft, sich vernünftig von Eileen zu verabschieden. Es gab kein Gespräch wie das mit der älteren Mrs. Webster. Eileen war weg, er hatte alle Hände voll zu tun – und hat wenig auf sich selbst geschaut, sich vielmehr auf die Kinder fokussiert. Die lange Auseinandersetzung mit Mrs. Webster (und sogar deren Ehemann), das Anhören ihrer Pläne, das sich-Öffnen hilft ihm, zu erkennen, dass er es bisher versäumt hat, einen klaren Abschluss zu finden. Die beiden Alten, die alles hinter sich lassen, um ein neues Leben zu beginnen, helfen ihm, dasselbe zu tun.
Die Namensgebung ist bemerkenswert:
Carlyle kann mit einer Festung verbunden werden – und im Zusammenhang mit der Geschichte sehe ich es so, dass er Eileens Angriffen (ihrem Weggang, ihren ihn überfallenden Anrufen, ihrer Einmischung) ausgesetzt ist, selbst jedoch wenig entgegensetzt. Er versucht, die Kinder zu schützen, ihnen ein gutes Leben zu geben, so stabil, wie es ihm möglich ist.
Der Familienname Webster, den, so möchte ich es sagen, „die Dame seiner Rettung“ trägt, steht dafür, dass sie ihm zu der Erkenntnis verhilft, dass er seinen eigenen Lebensweg finden (weben) muss – und sie lebt es ihm vor.
Für mich überaus wichtig sind diese Sätze: „In der Schule ließen sie gerade das Mittelalter hinter sich und gelangten zur Gotik. Die Renaissance lag noch in einiger Ferne und würde frühestens nach den Weihnachtsferien rankommen. Zu dieser Zeit wurde Carlyle krank.“(S. 198, 199)
Wir sehen hier eine Entwicklung und kriegen eine weitere in Aussicht gestellt: Mittelalter – Gotik (Emporstreben) – Renaissance (Wiedergeburt). Das Fieber zeigt an, dass er sich wehrt, kämpft. Er brennt sich den Weg aus seiner Krise frei, alle Zeichen stehen auf Transformation, auf Umdenken und Loslassen.
Die Kündigung von Mrs. Webster könnte eine Katastrophe sein. Sie ist es aber nicht. Er hat eine Entwicklung durchgemacht, erkannt, dass es weitergeht – und dass er selbst etwas dafür tun muss, dass er wieder glücklich wird.
Das Zaumzeug
The Bridle
Eine Familie mit zwei Kindern mietet ein möbliertes Zimmer. Sie kommen aus Minnesota, er, Holits, war Farmer, bevor er alles verlor. Lange Zeit scheint er ohne Arbeit zu bleiben, während Betty kellnern geht.
Die Geschichte wird aus Sicht von Marge erzählt, die die Zimmer im Auftrag vermietet und sich darüber hinaus als Hair-Stylistin bezeichnet. Schnell wird deutlich, dass sie mit ihrem Leben unzufrieden ist. Sie reimt sich viel über andere Menschen zusammen und versucht, sie am Reden zu halten, selbst wenn das bedeutet, dass sie ihnen eine kostenlose Maniküre gibt. Sie schreibt ihren Namen auf Geldscheine, malt sich aus, wo diese landen und dass die Leute sich fragen werden, wer sie ist. Über ihren Ehemann Harley, der die meiste Zeit herumsitzt, denkt sie abschätzig. Ihre Gespräche verlaufen wortkarg, oft antwortet sie ihm nicht einmal, nie erzählt sie ihm alles, was sie weiß – als ob sie es beschützen will, nicht teilen, nicht kleinreden lassen. Man spürt, dass sie sich allein und nicht gesehen fühlt. Ich glaube, dass sie etwas für sich haben möchte. Der Apartmentkomplex gehört nicht ihnen, allgemein scheint sie nicht viel zu haben, an dem sie sich erfreut. Sie wünscht sich Veränderung, auch Wasser, ein oft erwähntes Symbol, verdeutlicht das, denn es steht für die Wandlungsfähigkeit, nach der sie sich sehnt.
Nach einem Unfall, bei dem sich Holits verletzt, als er versucht, betrunken vom Dach des Badehäuschens in den Pool zu springen, zieht die Familie weiter. Zurück bleibt das titelgebende Zaumzeug, das er beim Einzug hoch ins Zimmer Nummer 17 getragen hat. Es gehörte seinem Pferd, das kein Rennen gewann und das er nach seiner Frau Betty benannte. Dieses Lederzaumzeug verdeutlicht Marge, wie sehr sie selbst geleitet wird. Sie arbeitet jeden Tag für andere, ohne etwas zu haben, auch keine Freude, keinen liebenden Ehemann, nichts. Das Zaumzeug kann als Einschränkung gesehen werden, als Zügelung. Aber sie sieht einen Reiz darin, denn sie fühlt sich ohnehin gefangen. Mit Zaumzeug, so denkt sie, würde sie „wissen, dass du unterwegs bist, irgendwohin“ (S. 236) – und das ist, was sie will.
Kathedrale
Originaltitel: Cathedral
Durch „Kathedrale“ bin ich zu Raymond Carver gekommen. In dem Schreibratgeber von A. Steele wird die Kurzgeschichte auseinandergenommen – und da ich den gelesen habe, werde ich zu der Story nichts sagen. Ich bin voreingenommen und weiß nicht, was mir hier aufgefallen wäre und was nicht.
Fazit
Ich geb’s zu: Zwischendrin hatte ich keine Lust mehr. Das ist mir noch nie passiert bei Carver – und ich bin froh, dass es nicht anhielt. Größtenteils hatte ich viel Spaß mit der Sammlung, „Federn“ und „Fieber“ könnten diesmal meine Favoriten sein, die meisten anderen sind ebenfalls gelungen. Ich freue mich auf das nächste Buch von ihm.
Zusammenfassung Kathedrale von Raymond Carver
Dieses Buch ist für dich, wenn du
- etwas mit Kurzgeschichten in einem ultraknappen Stil anfangen kannst
- Lust hast, das Gelesene zu interpretieren, um es zu verstehen
- über gewöhnliche, oft alkoholkranke Menschen in Ausnahmesituationen lesen möchtest
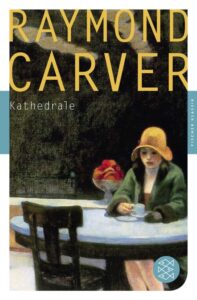
Kathedrale – Raymond Carver
Originaltitel: Cathedral (1983, 1989)
Übersetzung: Helmut Frielinghaus
Verlag: Fischer
Erschienen: 23.05.2012 / 2024
Seiten: 260
ISBN: 978-3-596-90389-4
„Kathedrale“ anschauen/kaufen:
Links mit einem Sternchen (*) sind Affiliate-Links. Wenn du einen Affiliate-Link anklickst und im Partner-Shop einkaufst, erhalte ich eine kleine Provision. Für dich entstehen keinerlei Mehrkosten.
Mehr von Raymond Carver
- Favoriten, Klassiker, Kurzgeschichten
- Favoriten, Klassiker, Kurzgeschichten