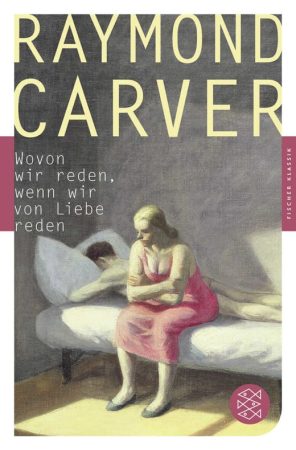
In „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“ von Raymond Carver gibt es 17 Kurzgeschichten über Menschen, die zu viel trinken und zu wenig kommunizieren, deren Beziehungen scheitern und die die Schattenseiten der Liebe erleben.
Inhalt
Aus 17 Kurzgeschichten besteht die Sammlung „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“ von Raymond Carver.
Wie in „Würdest du bitte endlich still sein, bitte“ geht es um einfache Menschen in schwierigen Situationen, um Probleme und Krisen, um Tatsachen, denen widerstrebend ins Auge geblickt wird. Die Mischung ist so bunt wie das Leben, die Charaktere so lebendig wie wir.
Erneut gibt uns der Autor Einzelteile, die wir zu einem Bild zusammensetzen müssen. Hier ist Grübeln gefragt, um den Sinn der einzelnen Kurzgeschichten zu verstehen, mit bloßem Herunterlesen ist es meist nicht getan. Das macht den Reiz aus – und ich hatte wieder den Spaß meines Lebens, ehrlich.
Übersicht
Ich habe zu jeder Kurzgeschichte meine Gedanken und Interpretation aufgeschrieben. Wenn du auf der Suche nach der Deutung eines bestimmten Titels aus „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“ bist, bringt dich ein Klick hin:
- Warum tanzt ihr nicht?
- Sucher
- Mr. Coffee und Mr. Fixit
- Pavillon
- Ich konnte die kleinsten Dinge erkennen
- Tüten
- Das Bad
- Sag den Frauen, dass wir wegfahren
- Nach den Jeans
- So viel Wasser so nah bei uns
- Das Dritte, was meinen Vater umgebracht hat
- Ein ernstes Gespräch
- Ruhe
- Volkstümliche Mechanik
- Alles klebte an ihm
- Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden
- Nur eins noch
Warum tanzt ihr nicht?
Originaltitel: Why Don’t You Dance?
Ein schöner Anfang, denn das ist eine von den Storys, die ich so mag von Raymond Carver. Ich lese sie, ich finde sie absurd, am Ende frage ich mich, worum es ging – und dann versuche ich, herauszufinden, wovon sie tatsächlich handelt. Was. Für. Ein. Spaß. Ernsthaft, ich liebe es.
Wir haben hier einen Mann, der, so scheint es, jemanden verloren hat, eine Frau, seine Frau. Das steht da nicht, wie so vieles bei Carver, aber durch die Sätze „Seine Seite, ihre Seite. Daran musste er denken, während er seinen Whisky schlürfte.“ (S. 9) nehme ich an, dass sie gegangen ist – warum auch immer. Er trauert, versucht, darüber hinwegzukommen.
Das zufällig vorbeikommende Paar, das Interesse an seinen im Vorgarten aufgestellten Möbeln bekundet, ist ein kleiner Ausweg. War es sein Plan, das Mobiliar wegzugeben? Ich bin mir da nicht sicher, es sieht mir eher wie der Versuch aus, nicht mehr in der „alten Welt“ festzuhängen, sie (räumlich) hinter sich zu lassen. Aber er hat auch keine Bauchschmerzen, sie ihnen zu geben, der Preis scheint ihm egal (das Ergebnis ist das Verlockende, nicht das Geld, sondern die neue Leere, die die alte ablöst) – also warum nicht?! Und wo wir schon dabei sind:
„Warum tanzt ihr nicht?“
Der Mann ist einsam. Er bringt die zwei dazu, mit ihm zu trinken, er bietet ihnen mehr Sachen an, die sie mitnehmen sollen. Es geht um Verbindungen, er versucht, welche zu schaffen, auch zwischen ihnen, indem er sie auffordert, miteinander zu tanzen. Letztlich macht er mit. Für mich ist wichtig, dass er, als die Besucherin merkt, dass sie beobachtet werden, sagt: „Sie haben gedacht, sie hätten hier drüben alles gesehen, was es zu sehen gibt. Aber so was haben sie noch nicht gesehen, stimmt‘s?“ Was ist neu? Das Spielerische, das Austesten, die Verbindung?
Ich glaube, er wünscht ihnen, dass sie mehr Glück haben, als er es hatte. Er gibt ihnen seine Sachen in der Hoffnung, dass sie ihnen mehr bringen als ihm, mehr Freude, Tänze und Nähe.
Man liest heraus, dass die Begegnung für die Frau ein großes Rätsel bleibt – und ich glaube, darum geht es. Man kann Beziehungen zwischen Menschen nicht komplett verstehen. Sie ist noch jung – wird es ihr einmal ähnlich ergehen? Als ihr Freund meint, betrunken zu sein, streitet sie das ab – eine erste Abgrenzung von dem Fremden? Sie spielt den Abend herunter, lässt sich über den geschenkten Plattenspieler und die Platten aus. Ein Selbstschutz? Man weiß schließlich nie, wann, wie und warum Dinge zu Ende gehen werden, man weiß nur, dass man nicht die Fehler der anderen wiederholen möchte.
Sucher
Originaltitel: Viewfinder
Es klingelt an der Haustür, der Ich-Erzähler kriegt ein Foto von seinem Haus angeboten. Das Besondere: Der Mann, der es geknipst hat, hat keine Hände.
Die Story ist eine aus „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“, die sich leichter erschließt, denn schnell wird deutlich, dass die beiden etwas verbindet:
Während der Erzähler am Küchenfenster hing und deshalb mit abgelichtet wurde, beim Herumschauen erwischt und verewigt, fotografierte der Mann mit den Stahlhaken sein Haus. Als ihm das Bild angeboten wird, kommt ihm das Wort „Tragödie“ in den Sinn. Denn er lebt allein hier. Er langweilt sich, hat nichts Besseres zu tun, als in die Gegend zu starren. Er gibt es zunächst nicht zu, doch die Wahrheit ist: Alle sind ausgeflogen, seine Frau, seine Kinder. Er trägt es ihnen nach.
Der Besucher versteht das, weil er, so sagt er, wegen seiner Kinder ohne Hände lebt. Das Thema Verlust ist allgegenwärtig. Beide hegen einen Groll, doch während der Fotograf weitermacht, weiterzieht, hängt der andere fest – bis er mit ihm nach draußen geht, um sich blickt, nach vorne – und letztlich aufs Dach steigt, sodass sich in der Schlussszene seine Wut – endlich – entlädt.
Mr. Coffee und Mr. Fixit
Ein geläuterter Ich-Erzähler? So scheint es mir, denn zunächst haben wir jemanden, der ausschließlich Schlechtes zu sagen hat. Als er, seinerzeit (vor drei Jahren) arbeitslos, seine 65-jährige Mutter beim Knutschen erwischte – hart. Seine Frau, seine Kinder – verrückt. Er hat nur Negatives zu berichten.
Doch nun sieht er die Welt anders, hat Frieden geschlossen mit der Vergangenheit, erkennt, dass seine Mutter vielleicht versuchte, den Tod seines Vaters zu überwinden, akzeptiert, dass seine Frau Myrna (= die Geliebte) eine Affäre mit jemandem hatte, den er Mr. Fixit nennt.
Alkoholismus ist ein Thema der Geschichte, der Alkohol brachte Verbindungen zustande oder beendete sie. Ihm hat er das Kennenlernen mit seiner Frau bei den Anonymen Alkoholikern beschert, aber auch die Beziehung zwischen Myrna und Ross (Mr. Fixit) sowie womöglich den Verlust des Vaters.
Für mich zeigt die Geschichte auf, dass Menschen kommen und gehen, wenn man nichts dagegen tut.
Es gibt hier einen Kreislauf. Der Arbeit kommt ein hoher Stellenwert zu: Ross hatte angeblich beruflichen, später freundschaftlichen Kontakt zu Astronauten und weiß davon zu berichten. Seit er diese glanzvolle Aufgabe verloren hat, trinkt er wieder – und hat vermutlich auch nicht mehr viel mit Myrna zu tun. Unser Erzähler hat hingegen einen Job angenommen und das Trinken aufgegeben, beurteilt sein Leben und das, was er sieht, nun anders. Sogar Ross wünscht er das Beste – warum nicht? Er war selbst einmal in seiner Lage. Für ihn ist jetzt aber alles besser geworden. Bleibt zu hoffen, dass er den Kreislauf nachhaltig unterbrochen hat, woran sie nun wieder gemeinsam arbeiten, indem Myrna als Abschluss sagt: „Wasch dir die Hände.“ (S. 26) Bleib sauber.
Pavillon
Originaltitel: Gazebo
Das Ende einer Beziehung, wie so oft in „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“:
Ich-Erzähler Duane und seine Holly haben ein Motel übernommen. Alles sollte besser werden – und für ein Jahr war es das, doch dann, Duane fängt etwas mit der mexikanischen Reinigungskraft an, zerbricht das Vertrauen. Seither fühlt sich Holly wertlos, hat Stimmungsschwankungen bis hin zu Suizidgedanken.
Für mich geht es hier darum, dass man sich abfindet mit etwas. Er ist hineingestolpert in diese Affäre – und findet nicht recht hinaus. Er sagt über Juanita: „Sie lächelt und sagt meinen Namen“ (S. 29), nicht „lächelte“ und „sagte“, obwohl sonst die Vergangenheit genutzt wird, wenn es um dieses Zusammentreffen geht. Es ist in seinem Kopf immer noch so. Ganz im Gegensatz zu „Holly war meine einzige wahre Liebe.“ (S. 32) War. Er will nichts ändern, ist gefangen in seiner Antriebslosigkeit, trinkt mit großer Ernsthaftigkeit, während er das Motel zugrunde gehen lässt, alles kommt zu einem ein Ende.
Holly plant, weiterzumachen (wenn sie sich nicht gerade umbringen will), denkt daran, nach Nevada zu gehen. Sie ist diejenige, die Träume hat(te), beispielsweise den, ein glückliches altes Paar zu sein wie das, das sie mit dem titelgebenden Pavillon verbindet. Doch diese Vorstellung hat sich als Illusion entpuppt. Bezeichnend auch, dass sie die beiden für tot hält – und sie (Holly und Duane) die Außenwelt ebenfalls nicht hereinlassen. Diese Träume sind gestorben. Für ihn ist das okay, er hat nichts gegen etwas Schnelles, er weiß womöglich selbst nicht, was er will, akzeptiert alles, was geschieht. Sie aber trauert.
Interessant ist auch der Name des Getränks, das mehrfach zur Sprache kommt: Teacher‘s. Alkohol ist kein guter Ratgeber – und trägt nicht gerade dazu bei, genügend Verantwortung und Antrieb aufzubringen, um eine Ehe und ein Motel zu führen. Sie weiß mehr als er, heißt es, und der erste Satz „Am Morgen gießt sie mir Teacher‘s über den Bauch und leckt ihn auf.“ (S. 27) unterstreicht das: Er ist derjenige, der noch einiges lernen muss. Ob er ohne sie zurechtkommen wird, ist fraglich. Vorher jedoch muss sie es zustande bringen, die Biege zu machen. Bleibt zu hoffen, dass es ihr gelingt, immerhin verlangt sie nach mehr von dem Zeug.
Ich konnte die kleinsten Dinge erkennen
Originaltitel: I Could See the Smallest Things
Ich-Erzählerin Nancy steht auf, als sie hört, dass die Gartenpforte geöffnet wird. Sie sieht niemanden, geht dennoch raus, um nachzuschauen, da ihr das offene Tor keine Ruhe lässt. Sie bezeichnet es als „Mutprobe“. Und hier haben wir für mich ein Thema: Abwechslung. Fortkommen. Denn normalerweise passiert nichts in ihrem Leben mit Cliff, den sie zu wecken versucht. „Ich schob und stieß ihn. Aber er stöhnte nur.“ (S. 38), heißt es, und „Er lag da wie ohnmächtig.“ (S. 37) Nichts ist los mit ihm. Das Leben: erstarrt.
Als sie im Begriff ist, die Pforte zu schließen (das Abenteuer zu beenden), trifft sie auf den Nachbarn. Bei Sam Lawton ist ordentlich was los: Er verlor seine Frau, heiratete sie, wurde Vater, verlor seine Frau endgültig, trank, gab das Trinken auf. Nicht alles davon ist schön, keine Frage, aber Stillstand gibt’s bei ihm nicht, er kann ja nicht einmal aufhören zu kauen.
Sam zeigt ihr die Schnecken, die er in ein Einmachglas sammelt. Er tut etwas gegen diese langsamen Tiere, ist allgemein aktiv, im Gegensatz zu Cliff – und zu Nancy, von der es im Garten noch heißt: „Ich dachte bei mir, das muss ich mir gut merken, wie es ist, draußen herumzuspazieren, einfach so.“ (S. 39), ehe sie zurückkehrt in ihr festgefahrenes Leben.
Abschließend: Den Zaun halte ich für bedeutsam. Nach einigem Alkohol baute Sam einen, woraufhin Cliff einen errichtete. Beide machten die Schotten dicht. Sam deutet an, wieder mit Cliff in Kontakt kommen zu wollen – wohl weil ihm sein turbulentes Leben selbst nicht geheuer ist. Das seiner Nachbarn ist ja auch berechenbarer, kontrollierbarer. So ist es manchmal – man will das, was man nicht hat. Davon kann Nancy ein Lied singen.
Tüten
Originaltitel: Sacks
Buchvertreter und Ich-Erzähler Les trifft seinen Vater, den er seit mehreren Jahren – seit der Scheidung der Eltern – nicht gesehen hat. Dieser nutzt das Treffen, um ihm von seiner Affäre zu berichten: Palmer hat seine Frau – Les‘ Mutter – mit der Vertreterin Sally Wain betrogen.
Dies ist eine der Kurzgeschichten in „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“, die mich Nerven kostete. Man kann sie in verschiedene Richtungen lesen, finde ich. Das ist herausfordernd bis frustrierend – und ich mag das. Herrlich, wenn man nicht aufhören kann, über die Geschichten nachzugrübeln und immer neue Details entdeckt.
Was ich sagen kann, ist Folgendes:
Zunächst zum Titel: Tüten, nach dem Original eher: Säcke. Sein Vater versucht, ihm etwas mitzugeben von sich, etwas abzuladen bei ihm. Les lässt die Süßigkeiten für Frau und Kinder da, nimmt aber trotzdem etwas mit: eine Erkenntnis.
Für mich geht es in der Story um Verständnis: Der Vater vergewissert sich in einem fort, dass sein Sohn ihm folgen kann – er möchte so gerne verstanden werden, will, dass man ihm Verständnis entgegenbringt.
Verständnis kriegt er nicht, der Vater. Zwar verurteilt Les ihn nicht, aber sie kommen auch nicht auf einen Nenner. Nachdem er fragt „Ist er nicht hinter dir her?“, sieht Palmer sen. ihn verständnislos an und wirft ihm vor, keine Ahnung zu haben. Bloß: Wovon? Ich denke: Davon, wie es nach (Entdeckung) einer Affäre weitergeht. Davon, dass keiner der Beteiligten einfach darüber hinwegkommt.
Als sein Vater nachschiebt: „Du weißt nichts, außer wie man Bücher verkauft.“ (S. 51) – was meint er? Dass Les blind ist für das Offensichtliche? Weckt er ihn auf damit?
In der Anfangsszene (im Hotel) sagt er: „Ich sehe, wie in einigen Gebäuden nach und nach Lichter angehen, wie von den hohen Schornsteinen in dicken Säulen Rauch aufsteigt. Ich wünschte, ich müsste nicht hinsehen.“ (S. 43), was für mich darauf hindeutet, dass er allein ist und es ihm nicht gut geht damit. Er möchte nicht, dass die Lichter angehen, will nicht sehen. Nicht wahrhaben. Aber was? Die Liaison? Dass die Ehe zu Ende ist? Es kein Zurück gibt zur Normalität?
Ich denke, er steht hier kurz vor der Trennung von Mary und den Kindern („‚Denen geht’s gut’, sagte ich, was nicht der Wahrheit entsprach.“ (S. 44) + der vorletzte Satz), obwohl er versucht, es zu verdrängen. Auch in anderen Situationen schaut er weg, mag nichts sehen von dem Spiel zwischen Mann und Frau.
Am Ende führt er seinen Vater, will ihn ins Taxi setzen (Palmer hat kein Auto, was gedeutet werden kann in Richtung Selbstbestimmung: Sein Leben ist durch diese Erfahrung außer Kontrolle, aus seiner Kontrolle geraten). Les übernimmt Verantwortung – und wird auch selbst eine Entscheidung treffen (müssen), die wiederum zum letzten Satz führt. So hat jeder sein Päckchen zu tragen, egal, inwiefern er sich schuldig gemacht hat oder nicht.
Das Bad
Originaltitel: The Bath
Eine Mutter bestellt eine Raumschiff-Torte für den 8. Geburtstag ihres Sohnes Scotty, doch die Party wird abgesagt, nachdem er auf dem Schulweg angefahren wird. Seine Eltern warten im Krankenhaus, dass er die Augen aufschlägt, nach stundenlangem Ausharren entscheidet sich der Vater, nach Hause zu fahren, um ein Bad zu nehmen. Natürlich wäscht das Wasser nichts weg von seiner Angst, er findet keine Wärme, Geborgenheit, Entspannung, auch, weil das Telefon klingelt – die Torte ist fertig. Er weiß nichts davon, dass seine Frau Ann diese bei dem wortkargen Bäcker bestellt hat, beendet das Gespräch. Und das ist ein Thema der Geschichte: Fehlende (klare) Worte. Kommunikation.
Der Mann redet das Nötigste, der Kumpel verrät sein Geschenk nicht, Scotty spricht nicht mit seinem Freund, nachdem er zu Boden ging, seit er im Koma liegt, kommt kein Laut über seine Lippen. Der Arzt spart sich Klartext; wenn er etwas sagt, dann eher über Ann als zu ihr, auch der Ehemann tut das. Es gibt allerhand (oft kalt wirkendes) Schweigen – und daraus resultierend viel Unsicherheit und Hilflosigkeit.
Ein einziges Mal bricht alles aus Ann Weiss heraus – gerade dort, wo es in diesem Moment niemanden interessiert. Sie weiß: Es ist das (Ver-) Schweigen, das mit das Schlimmste ist. Deshalb versucht sie, die Stille zu vertreiben. Doch das bringt nichts, es sind nicht die Worte, die die Leute hören wollen. Und so geht die Geschichte zu Ende: Das Telefon klingelt, sie hofft auf Neuigkeiten. Wir erfahren, dass es ein Mann ist, der anruft – aber welcher? Er scheint zu stocken – liegt es an der Verzweiflung, die er in ihrer Stimme wahrnimmt? Ist es der hartnäckige Bäcker, der sein Geld will? Möglich. Oder der Arzt, der sie bis dahin nur Ann nannte? Hoffentlich nicht, wir wollen, dass sich Scotty ins Leben zurückbeamt und es nur gute Nachrichten gibt, sodass die plötzliche förmliche Anrede nicht gebraucht wird. Und so bleiben wir zurück, wünschen uns das, was in dieser Geschichte fehlt: Mehr Worte, klare Aussagen, Trost.
Sag den Frauen, dass wir wegfahren
Originaltitel: Tell the Women We‘re Going
Die wohl schockierendste Kurzgeschichte aus „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“:
Bill Jamison und Jerry Roberts sind Freunde seit früher Kindheit, teilen alles – bis Jerry Carol heiratet (die sie bis dahin auch teilten). Bill kommt mit Linda zusammen, sie sehen sich wieder regelmäßig bei Jerry, der bereits Kinder hat.
Wie der Titel verrät, fahren die Männer bei einem dieser Treffen alleine weg. Sie stoppen beim „Recreation Center“ und trinken etwas, wobei auffällt, dass niemand von ihnen, Bill/Jerry/Riley, die Frage nach dem Befinden beantwortet. Es ist eine allseitige Unzufriedenheit zu erahnen. Jerry sieht älter aus, als er ist, hat sich verändert, wirkt abwesend, die Verbindung der einst Unzertrennlichen hat mit Jerrys Hochzeit einen Riss bekommen, der noch heute spürbar ist.
Sie fahren weiter – und Jerry wird übermütig, will zwei junge Radfahrerinnen aufgabeln. Er redet unflätig daher, verfolgt sie. Hier ist von Bedeutung, dass Bill sich anschließt, er macht mit, aber nicht, weil er auf dasselbe aus ist wie Jerry. Bill geht davon aus, allerdings denken sie nicht mehr in dieselbe Richtung. Er ist nicht so hartnäckig wie Jerry, schlägt mehrfach vor, einen Rückzieher zu machen. Im Verlauf verliert er das Auto (sie haben sich immer eins geteilt, das ist wichtig) aus den Augen, den Highway, er folgt nur noch, entscheidet nicht selbst, verlässt die geregelten Bahnen. Er baut darauf, dass es ist wie früher, dass er seinem Freund vertrauen kann, dass sie dasselbe wollen – doch so ist es nicht.
Das Ganze endet in einer Katastrophe. Dass Jerry gewisse Aggressionen in sich trägt, deutet sich durch seinen Schlag in den Bauch, das Zerdrücken der Dose und seine Wortwahl an. Dass es so ausufert, überraschte mich dennoch. Die Wut, die sich in seiner Ehe aufgestaut und auf Frauen im Allgemeinen übertragen hat, entlädt sich hier. Man erwartet Schlimmes (eine Vergewaltigung, um es zu benennen), aber das reicht ihm nicht (Carol ist schon wieder schwanger, womöglich ist das der Grund, weshalb es ihm eben nicht darum geht. Die Ehe, die Kinder, die Verantwortung – er will nicht noch mehr davon).
Dass er Bill in den Bauch boxt und sich später beide Frauen vornimmt, obwohl er Barbara seinem Kumpel zugesprochen hat, lässt eine Wut gegen ihn vermuten. Schließlich hätte genauso gut Bill Carol heiraten – und Jerry „frei“ sein können.
Nach den Jeans
Originaltitel: After the Denim
Edith und James Packer gehen – wie so oft – zum Bingo, doch diesmal ist es anders: Der Parkplatz belegt, die Stammplätze von einem jungen Paar besetzt, das sich in Jeans und Jeansjacke, langhaarig und mit Schmuck behangen präsentiert. Es sollte ein Freitagabend wie jeder andere werden, der Buchhalter im Ruhestand ist empört. Schnell kommen wir dahinter, weshalb: Die beiden führen ihm vor Augen, dass er langsam „abgelöst“ wird. Sie sind eine andere Generation, gehören nicht mehr der an, die jetzt in Jeans und mit Ohrring durch die Gegend rennt. Deren Unbeschwertheit – sie schummeln ja sogar! Irgendwann aber ist es vorbei mit der Leichtigkeit, da wird man verdrängt vom Platz der Gewinner, kommt nicht länger durch mit allem. Der widerstandsfähige Jeansstoff wird ersetzt, man wird angreifbarer, auch gesundheitlich – wie Edith, die nach dem Toilettenbesuch verkündet: „Die Flecken sind wieder da“ (S. 79) Zu Hause sagt sie: „Ich glaube, da unten ist was Ernstes im Gange.“ (S. 82) James spuckt dann noch Tomatensaft weg – soll uns das alles auf das Thema Blut stoßen?
Es fällt auf, dass Edith immer „ich“ sagt, nie „wir“, was ein zusätzlicher Hinweis sein könnte. Wollen sie ein Baby haben? Hält die Schwangerschaft (erneut) nicht, weil sie älter sind und somit das Risiko für Komplikationen erhöht ist? Weiß sie es, wagt sie deshalb kein „Wir“ – und sei es nur, um James einzuschließen?
Der ist frustriert und traurig, sie wurden verdrängt – mit welchem Recht? Sie sind erfahrener, wissen mehr – was zur Sprache kommt, wenn er sagt: „Er würde ihnen sagen, was auf einen wartete – nach den Jeans und nach den Ohrringen, nach den Berührungen und den Betrügereien beim Spiel.“ (S. 83)
Er ist wütend, er ist machtlos, gegen die Verdrängung kann er so wenig ausrichten wie gegen die gesundheitlichen Probleme. Aber er ist auch mitfühlend seiner Edith gegenüber – ein Halt, den er gerade ebenfalls braucht. So widmet er sich dem Sticken – hier hat er den blauen Faden unter Kontrolle.
Das Winken am Ende – ein Abschied. Die sorgenfreien Tage sind gezählt, der Bingo-Abend hat sie eingeläutet, die stürmische Zeit.
So viel Wasser so nah bei uns
Originaltitel: So Much Water So Close to Home
Dies ist eine Kurzgeschichte, die es mir etwas schwerer machte.
Der Einstieg ist spannend, die kühle Atmosphäre, die Ich-Erzählerin Claire, die uns von einem Ausflug ihres Mannes mit seinen Freunden erzählt, der es in sich hat:
Letzten Freitag, sie fuhren in die Berge, um zu angeln, entdeckten sie die Leiche eines Mädchens. Statt umzukehren, schlugen sie ihr Nachtlager auf, holten sie ans Ufer, banden sie fest. Am nächsten Tag angelten sie wie geplant, am übernächsten reisten sie ab – und erst dann informierte Stuart, der Mann der Erzählerin, die Polizei. So weit, so schockierend.
Claire will dennoch etwas unternehmen mit ihm, sie fahren zu einem Picknick-Gelände. Ihr fällt ein Bach auf, sie denkt „So viel Wasser so nah bei uns“ und fragt: „Warum musstet ihr so weit fahren?“ (S. 89) Er würgt sie ab, doch sie erinnert sich an ein Verbrechen, das in ihrer Kindheit passierte. Im Verlauf wird deutlich, dass sie traumatisiert ist und Männern im Allgemeinen (auch ihrem) misstraut. Sie geht auf Abstand.
Während er nicht zurückschaut (wenn sie das Geschirr runterwischt zum Beispiel), besucht Claire die Beerdigung des Mädchens. Bemerkenswert finde ich die Szene mit ihrer Friseurin:„‚Wir waren uns nicht sehr nah‘, sagte ich. ‚Aber du weißt ja.‘“ Was weiß sie denn? Dass Stuart und seine Freunde Gordon Johnson, Mel Dorn und Vern Williams auf der Titelseite der Zeitung und womöglich in Verbindung mit dem Verbrechen stehen? Sehen es alle wie Claire? Zumindest der Telefonanruf am frühen Morgen (ein Journalist?) deutet darauf hin, dass sie nicht die Einzige ist, die seine Beteiligung in Betracht zieht (eine Story wittert?), zudem äußert sie ihm gegenüber mehrfach, er wisse es – als wäre er schon anerkannt verurteilt worden. Umso seltsamer die Abschlussszene – und auch wieder nicht. Sie tut, was sie dafür hält, das von ihr erwartet wird. Ihre Schwiegermutter will, dass abgenommen wird, wenn sie anruft, sie fegt auf, was sie in Wut kaputtwirft, die Menschen wollen Anteilnahme sehen, Stuart meint zu wissen, was sie braucht – also spielt sie mit. Ihre Zweifel bleiben, ihre Angst ist größer (das Wasser ist wichtig, am Ende rauscht es, übertönt, was sie eigentlich will. Das Wasser ist ihre Angst), aber sie tut es – wie der letzte Satz unterstreicht – für den gemeinsam Sohn Dean, dessen Kindheit nicht so abrupt enden soll wie ihre eigene.
Ich geb‘s zu: Claire ist eine unzuverlässige Erzählerin. Aber ganz ehrlich: Die Truppe hat sich irrsinnig verhalten. Fraglich ist nicht, ob sie etwas falsch gemacht hat, sondern nur wie viel. Man rätselt mit – und versteht Claire, egal wie begründet ihr Misstrauen ihrem eigenen Mann gegenüber zum aktuellen Zeitpunkt ist.
Das Dritte, was meinen Vater umgebracht hat
Originaltitel: The Third Thing that Killed My Father Off
Selten bei Carver, nicht nur in „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“: Die Geschichte beginnt direkt mit der Einbindung des Titels. Wir erfahren: Dummys Tod ist Punkt drei auf der Liste der Dinge, die den Vater des Erzählers umbrachten.
Dummy, dessen richtigen Namen wir nie lesen, ist seit jeher ein Außenseiter. Er wohnt draußen, es werden Witze auf seine Kosten gemacht, seine Frau soll mit Mexikanern flirten. Niemand scheint ihm ernsthaft wohlgesonnen. Er gilt als taub, spricht nie.
Der einfache Arbeiter verändert sich, nachdem er auf Hinweis von Del Fraser (er ist der Vater von Jack, der aus der Ich-Perspektive berichtet) drei Fässer Schwarzbarsche für seinen Teich bestellt, den er fortan mit einem Zaun sichert. Ich glaube: Er will etwas behalten, nur für sich, nicht teilen. Deshalb möchte er auch nicht, dass die Frasers (oder sonst jemand) zum Angeln kommen. Wegen eines Vorwands kriegen sie letztlich doch einmal die Gelegenheit, aber mitnehmen dürfen sie keinen der Barsche, die sich sehr wohlfühlen bei Dummy.
Die Hinweise, dass etwas passiert, verdichten sich, als Dummy mit den Frasers zusammen ist: Blut beim Auspacken der lebenden Lieferung, die Schoten „rasselten zornig.“ (S. 102) Und es geschieht tatsächlich:
Im Februar tritt der Fluss über die Ufer, die Überschwemmung nimmt viele Fische mit sich, hinterlässt eine tote Kuh und Dummy, den Jack wie folgt beschreibt: „Er stand einfach nur da, der traurigste Mensch, den ich je gesehen hatte.“ (S. 107) Er will etwas behalten, wenn schon nicht seine Frau, doch es klappt nicht. Er sieht ein, dass er weder in der Stadt noch zurückgezogen auf dem Land sein Glück findet – und so beendet er das Leben seiner Frau sowie sein eigenes. Bereits zuvor zeichnet sich ab, dass er sich weniger bieten lässt: Er wehrt sich gegen seinen Kollegen, geht nicht mehr pflichtschuldig jeden Tag zur Arbeit, um sich mobben zu lassen. Er macht dem ein Ende. Er. Er wartet nicht darauf, dass jemand anderes (und sei es die Natur) es tut.
Dass er sich ertränkt, ja, aus seinem Teich „geangelt“ wird, unterstreicht noch einmal, wie wichtig ihm die Fische waren, die so zahlreich den Menschen zum Opfer fallen.
Interessant ist, dass Del versucht, die Schuld auf die Frau zu lenken. Sein Sohn glaubt nicht daran – und ich auch nicht. Ich denke, er weiß, dass er sich mitschuldig gemacht hat. Gerade die Tatsache, dass er das „Angeln“ mitangesehen hat, wird es ihm deutlich vor Augen geführt haben. Jack hat das erkannt – es (sein Schuldgefühl) war das Dritte, was seinen Vater umgebracht hat.
Ein ernstes Gespräch
Originaltitel: A Serious Talk
Wir folgen Burt, der am Tag nach Weihnachten Vera aufsucht. Gestern hat er hier gefeiert mit ihr und den Kindern, dann ist etwas vorgefallen – und heute will er sich entschuldigen.
Es wird deutlich, dass er die Trennung, Vera hat einen Neuen, nicht verwunden hat, er spricht von „seinem Haus, seinem Zuhause“ (S. 112) und versucht noch immer, seine Frau zu kontrollieren. Dass er den Aschenbecher, den er ebenfalls als seinen betrachtet, wegen der fremden Zigaretten reinigt, ist der Versuch, sein Eigentum wieder sauber zu machen, den Schmutz wegzuwaschen. In diesem Zusammenhang ist interessant, dass die Gegenseite, Vera (und Anhang), alles so lässt, wie es ist. Gestern hat Burt eine Torte fallen- und liegenlassen, sie ist noch immer dort. Ebenso die Reste der Feier. Es stört sie nicht. Aber Burt wird deutlich vor Augen geführt, was geschieht.
Seine Frau hat nicht nur einen neuen Mann an ihrer Seite, sie soll Burt auch etliche Male betrogen haben. Ich glaube, dass Carver nicht zufällig sechs Torten eingebaut hat oder die Tatsache, dass Vera für den Flötenunterricht angemeldet ist. Sie nimmt überdies einen Telefonanruf an von einem Mann, der „Charlie“ sprechen will, zieht sich dafür ins Schlafzimmer zurück. Dass der Apparat klingelt, als das Wasser zu kochen anfängt, halte ich für einen weiteren Hinweis. Auch die Raucherei. Wir glauben, dass es stimmt.
Das ist nicht okay.
Aber:
Während Vera längst über ihn hinweg ist, lassen seine Taten noch immer an Kurzschlusshandlungen denken. Er hat ein Alkoholproblem und einige andere. Wir verstehen, dass es kein Zurück gibt. Es geht nicht mehr um die Schuldfrage, um wieder zueinanderzufinden, es braucht lediglich eine Lösung, um irgendwie auszukommen miteinander – und zwar als getrennte Menschen. Auch wenn er am Ende ein klärendes Gespräch ankündigt, wissen wir, dass es nichts zu sagen gibt (er will über den Aschenbecher/Teller reden, nicht über seine wahren Gefühle). Am Schluss legt er den Rückwärtsgang ein – nichts deutet darauf hin, dass er in irgendeiner Art und Weise nach vorne schauen und etwas ändern wird. Leider.
Ruhe
Originaltitel: The Calm
Eine starke Geschichte aus „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“:
Ein Ich-Erzähler lässt sich die Haare schneiden und beobachtet drei Männer, die warten. Einen erkennt er: Charles, der Wachmann einer Bank. Von Bill, dem Friseur, angesprochen, erzählt Charles von seiner Jagd, davon, wie er mit seinem Sohn einen Hirsch erlegen wollte, der jedoch (aufgrund der „Schwäche“ des Jungen) entkommen ist.
Für mich geht es in dieser Geschichte um Männlichkeit und Sicherheit, um Stärke/Schwäche, Mut und Feigheit.
Die Wartenden geraten aneinander, weil Albert findet, Charles müsste sich um den Hirsch kümmern, statt in dem Laden abzuhängen. In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass Albert ein Lungenemphysem hat und als „halb tot“ (S. 126) bezeichnet wird. Der Kranke sympathisiert bzw. identifiziert sich mit dem angeschossenen Hirsch, der leidet und womöglich noch immer auf eine Erlösung wartet.
Charles und Albert stehen kurz vor einer Schlägerei, der Dritte stachelt sie zusätzlich an, doch der Friseur sorgt nicht nur durch schützende Gesten dafür, dass sich der Erzähler sicher fühlt, er sorgt auch für Ruhe. Bedeutsam ist, dass anfangs bezweifelt wird, dass Bill ein Jäger ist. Er ist, wie er am Ende der Geschichte unter Beweis stellt, ein sanfter Mann. Und trotzdem hat er sich gegen die Pöbelnden durchgesetzt. Man muss nicht gewalttätig sein, um Stärke zu demonstrieren. Obwohl er täglich eine (potenzielle) Waffe bei sich trägt, setzt er sie nicht ein, um anderen zu schaden, im Gegenteil.
Die letzten Sätze können verschiedentlich verstanden werden. Wird hier eine Beziehung zwischen Bill und dem Erzähler suggeriert? Sicher ist: Erst als die aufbrausenden Männer den Laden verlassen, fühlt der Erzähler die titelgebende Ruhe und den Mut, um eine längst überfällige Entscheidung zu treffen. Das wieder wachsende Haar lese ich als Erkenntnis, Weisheit. Gleichzeitig kann er es abschneiden lassen, kann sich verändern, kann beispielsweise das Angeln, das womöglich seinen „männlichen Anteil“ darstellen soll, ablegen, wenn er will. Es liegt bei ihm – und der Friseur hat ihm die Sicherheit vermittelt, die er braucht, um zu wissen, dass er sich jederzeit auch auf sanfte Art im Leben behaupten wird.
Volkstümliche Mechanik
Originaltitel: Popular Mechanics
Ein Paar, er hat seinen Koffer gepackt und will gehen, streitet sich um das gemeinsame Baby. Es endet in einem Tauziehen – und keiner von beiden gibt nach.
Ah, keine schöne Geschichte. Carver legt den Fokus voll auf die schockierende Handlung, niemand kriegt einen Namen, es gibt keine Anführungszeichen (was auch den Mangel an Kommunikation unterstreicht. Selbst wenn sie etwas sagen, ist es kein konstruktives Gespräch, statt zu sprechen, streiten sie). Der weiße Schnee schmilzt, hinterlässt schmutziges Wasser, es herrscht Dunkelheit, ein Blumentopf zerbricht. Keine gute Ausgangslage. Und so geht es weiter:
Die beiden konzentrieren sich komplett auf ihre Interessen, niemand denkt wirklich an den Sohn, an dem gezerrt wird. „Ich will den Kleinen“ und „Lass ihn los“ (S. 130) werden wiederholt – er will, sie soll.
Einmal hat sie Bedenken, er könnte dem Baby wehtun, was er verneint – dennoch ziehen beide weiter, weshalb wir den Einwand nicht sehr ernst nehmen.
Ich wollte, dass es so ist wie in Brechts „Der kaukasische Kreidekreis“, wenn es denn schon derart dramatisch sein muss. Aber ich habe es nicht gekriegt.
Ich kann das Baby auch symbolisch für die Beziehung ansehen. Zunächst will er ein Foto mitnehmen (Erinnerung an die guten Zeiten), letztlich streiten und reißen sie, niemand gibt nach, sie vergessen völlig, dass es einmal anders war zwischen ihnen. Hier kommt für mich der Titel in Spiel: Viele Partnerschaften gehen so zu Ende (was ein weiterer Punkt für die Namenlosigkeit der Beteiligten ist). Jeder will etwas, nur nicht nachgeben, es geht nur noch darum, dem Gegenüber zu schaden. Sie handeln aus ihrer Verletzung heraus.
Zweimal wird die Schulter erwähnt, die eine große Rolle spielt bei Bewegungen. Sie kann ebenfalls dafür stehen, Verantwortung zu übernehmen, aber auch Geborgenheit und Sicherheit zu vermitteln. Nichts davon trifft auf die zwei in dieser Situation zu.
Eine sehr kurze Geschichte aus „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“, aber auch eine der schlimmsten.
Alles klebte an ihm
Originaltitel: Everything Stuck to Him
Eine Story aus „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“, über die ich länger nachsinnen musste.
Zunächst haben wir hier einen Vater und seine Tochter, Letztere will etwas aus ihrer Babyzeit hören. Also wird erzählt (es gibt keinen Ich-Erzähler) von damals, als sie in der Nacht, bevor ihr Vater mit Carl zum Jagen gehen wollte, nicht aufhörte zu schreien, sobald man sie ablegte. Er wird immer als Junge bezeichnet, die Mutter als Mädchen. Sie waren noch nicht richtig erwachsen (das unterstreicht die Andeutung mit dem Briefpapier und seine Schwärmerei für die Schwestern seiner Frau).
Es kommt zu einer wichtigen Situation, als er sich ankleidet und losgeht, um zum Jagen zu fahren, es wegen der Drohung, er müsse sich entscheiden (Familie ja oder nein) aber nicht durchzieht. Nach seiner Rückkehr schlafen die Mädchen friedlich (brauchen ihn nicht), doch er geht trotzdem nicht. Ob er auf Dauer daran festhält?
Worauf der Titel „Alles klebte an ihm“ anspielt:
Als er sich für die Familie (auch seine Tochter wollte in diesem Moment an ihm „kleben“) und gegen die Jagd entscheidet, macht sie ihm eine Waffel, die er mit Sirup übergießt. Der Teller kippt ihm in den Schoß, alles klebt an seiner Unterhose. Der Satz „Und ich hatte solchen Hunger, sagte er und schüttelte den Kopf.“ (S. 140) fällt. Ich sehe hier eine Warnung: Er hat Hunger, er wollte jagen, er will auch andere Frauen. Aber wenn er etwas in die Richtung tut, wird dies an ihm kleben. Er wird es nicht abschütteln können. Deshalb sollte er sich gut überlegen, welche Schritte er geht.
Eingangs wird erwähnt, dass die Tochter über Weihnachten in Mailand ist und ihn dort trifft. Ich denke, die Eltern haben sich früh getrennt, sie ist bei ihrer Mutter geblieben. Er ist seit jeher Jäger – eventuell auch ein Schürzenjäger, was die Sätze rechtfertigt, die verraten, dass er auf die Schwestern seiner Frau stand. Hat er die Familie verlassen? Wir wissen es nicht. Doch seine Äußerung könnte es implizieren: „Die Dinge verändern sich, sagt er. Ich weiß nicht, wie sie das tun. Aber sie tun es, ohne dass man es merkt oder dass man es möchte.“ (S. 140) Sie sprechen keinen Klartext, seine Tochter und er, sie belässt es dabei. Aber das „trotzdem“ in ihrer Frage finde ich interessant, außerdem das „eine Zeit lang wenigstens“ (S. 141) aus dem letzten Satz. Ich glaube, es war so. Er ist letztlich jagen gegangen – was auch immer.
Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden
Originaltitel: What We Talk About When We Talk About Love
Da haben wir sie: Die vorletzte und dem Buch seinen Titel gebende Kurzgeschichte „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“ oder auch: Der Versuch, zu erklären, was Liebe ist.
Wir erleben einen Gin-lastigen Abend der Freunde Dr. Mel(vin) R. McGinnis, Herzchirurg, seiner Frau Teresa, genannt Terri, dem Ich-Erzähler Nick und seiner Partnerin Laura.
Zunächst geht es um Terris Ex Ed, der sie misshandelt, aber – davon ist Terri überzeugt – auf seine Weise geliebt hat (Mel will davon nichts wissen). Wenn von Rattengift und Fangzähnen die Rede ist, könnte man meinen, er hätte sich in ein Tier verwandelt. Mel wurde von ihm bedroht. Letztlich brachte er sich um. Es hört sich ein wenig bewundernd an, wenn sie sagt: „Aber er war bereit, dafür zu sterben. Er ist dafür gestorben.“ (S. 148) Für die Liebe zu ihr. Geht es für sie darum? Jemanden zu finden, der zu einem solchen Schritt bereit ist, wenn er sie nicht haben kann? Dann wäre sie bei ihrem Mann an der falschen Adresse:
Mel hat beruflich viel erlebt und gesehen, berichtet insbesondere von einem Unfall auf der Interstate, bei dem ein junger Betrunkener fast ein Paar in den 70ern ums Leben brachte. Die Alten überlebten – und ihm machte es am meisten zu schaffen, dass er seine Angetraute durch die Verbände nicht sehen konnte. Mel kann das nicht nachvollziehen.
Spannend ist, dass sie trinken und trinken – und danach ein neues Restaurant testen wollen. Es ist geplant, hinzufahren – in ihrem Zustand. Das in Verbindung mit der Geschichte des alten Paares führt zu folgender Frage: Würden sie ebenso fühlen wie der Mann, dem es am meisten zusetzte, dass er seine Frau nicht sehen konnte? Der alles andere ertrug, nur das nicht? Ich denke: Mel wohl kaum.
Jede Liebe ist anders, so verstehe ich die Story. Manchmal ist sie laut und manchmal leise, mal offensichtlich und doch immer unerklärlich. Sie verändert sich mit der Zeit. Jeder sieht sie anders, nicht einmal der Herzchirurg kann sie wirklich erklären, vor allem, da seine erste Ehe scheiterte und er nun eher Hass für seine Ex empfindet als alles andere. Seine Kinder liebt Mel – und so unterlässt er einen Anruf, dennoch wünscht er deren Mutter einen tödlichen Bienenstich, was darauf hindeutet, dass die Abneigung ihr gegenüber größer ist als das Verständnis, dass seinen Kindern durch ihren Tod Schaden zugefügt werden würde (denn sie lieben ihre Mutter). Er geht als Arzt sehr sachlich an die Frage heran, was Liebe ist, geht davon aus, dass sich die Freunde nach einer kurzen Trauerphase jemand anderem zuwenden würden. Der Erzähler und Laura würden dem meiner Ansicht nach nicht leichtfertig zustimmen, sie lieben anders als Mel und Terri. Sie sind seit 1,5 Jahren zusammen (Mel sagt 18 Monate, um die Zeit kleiner zu machen; er verniedlicht den Erzähler auch, indem er ihn „Nicky“ nennt. Er hält sich für den mit mehr Erfahrung und Durchblick) – und doch denke ich, dass sie nach fünf Jahren nicht an der Stelle von Mel und Terri sein werden.
Die Geschichte geht ohne Gin (somit ohne die Lockerheit und Bereitschaft, weiter über dieses Thema zu sprechen) und in Dunkelheit zu Ende. Dort bleiben sie, die alle schon eine Ehe und Erfahrungen hinter sich haben, tappen weiterhin im Dunkeln auf der Suche nach der Antwort auf die Frage: Was ist Liebe?
Nur eins noch
Originaltitel: One More Thing
Eine Familie, die zerbricht:
L. D. hat ein Alkoholproblem und lebt auf Maxines Kosten. Als diese nach Hause kommt und ihn mit der 15-jährigen Tochter Rae streiten sieht, reicht es ihr. Sie schmeißt ihn raus.
Er packt seine Sachen (in ihren Koffer), nimmt alles mit, sogar Maxines Wimpernzange. Er schindet Zeit, will nicht gehen. Aber er muss.
Er bezeichnet das Familienheim als „Irrenhaus“, während Rae ihn immer wieder darauf hinweist, dass alles nur in seinem Kopf ist. Das ist wichtig. Er spielt auf allerhand Krankheiten an, Krebs usw., sagt indirekt: Ich bin krank, ich kann nicht aufhören zu trinken. Er sagt jedoch nie, dass er es will. Rae hält seine Äußerungen für Ausreden, lässt sie nicht gelten. Für sie ist das eine Frage des Willens, der Kontrolle – und dass er diesbezüglich Probleme hat, sehen wir daran, dass er sein Kind beschimpft, auf den Tisch schlägt und ein Gurkenglas schleudert (er wirft es aus dem Fenster, es fliegt raus, nach draußen – wie er gleich).
Auch Rae ist nicht unfehlbar. Sie schwänzt, sie raucht. Aber sie hat eine andere Verbindung zu ihrer Mutter, sie beschützen sich gegenseitig, während L. D. bedrohlich agiert. Noch wird ihr ihr Verhalten nicht zum Verhängnis. Es ist eben alles eine Frage der Dosis. Apropos:
Für mich ist die Namensgebung in der Geschichte bedeutsam:
Maxine, sie ist die Große, die Überlegene des Haushalts, sie verdient das Geld, sie wirft ihn raus.
L. D. ist eine gebräuchliche Abkürzung für letale Dosis / lethal dose – tödliche Dosis. Er hat zu viel getrunken, die Menge hat die Beziehung, das Familienleben umgebracht.
Zum Ende: „Er sagte: ‚Ich will nur noch eins sagen.‘ Aber dann fiel ihm nicht ein, was in der Welt das sein könnte.“ (S. 165)
Hier sind zwei Punkte von Bedeutung:
Dass ihm nichts einfällt, spielt auf Raes Aussagen an, dass alles im Gehirn entschieden wird.
Und: Die Kommunikation funktioniert nicht. Hat sie nie, nicht in letzter Zeit jedenfalls. Er hat in der Geschichte zu keinem Zeitpunkt über seine Gefühle gesprochen – und scheitert auch hier daran, in diesem Moment, in dem es wirklich darauf ankommt. Was für ein Abschluss – für das Buch insgesamt, denn genau darum geht es in „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“.
Fazit
Mein zweites Buch von Raymond Carver – und wieder ein Volltreffer. Ich mochte alles an „Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden“ und freue mich auf weitere Sammlungen von ihm.
Zusammenfassung Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden
Dieses Buch ist für dich, wenn du
- Kurzgeschichten magst
- Spaß daran hast, Texte zu interpretieren
- über Beziehungen lesen möchtest
- es verkraftest, dass oft Alkohol im Spiel ist
- etwas mit einem ultraknappen Stil anfangen kannst

Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden – Raymond Carver
Originaltitel: What We Talk About When We Talk About Love (1981)
Übersetzung: Helmut Frielinghaus
Verlag: S. Fischer
Erschienen: 23.05.2012
Seiten: 176
ISBN: 978-3-596-90388-7
Jetzt zu Amazon:
Links mit einem Sternchen (*) sind Affiliate-Links. Wenn du einen Affiliate-Link anklickst und im Partner-Shop einkaufst, erhalte ich eine kleine Provision. Für dich entstehen keinerlei Mehrkosten.
Mehr von Raymond Carver
- Favoriten, Klassiker, Kurzgeschichten
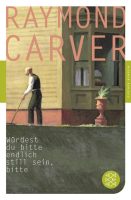
3 Antworten
Ah – klingt gut. Meine derzeitigen Kurzgeschichten sind auch eher zum Nachdenken.
Schön, dass der 2. Ausflug auch so toll war.
Oh ja, es hat mich wieder begeistert – und der 3. Ausflug steht kurz bevor. :)
Liebe Grüße